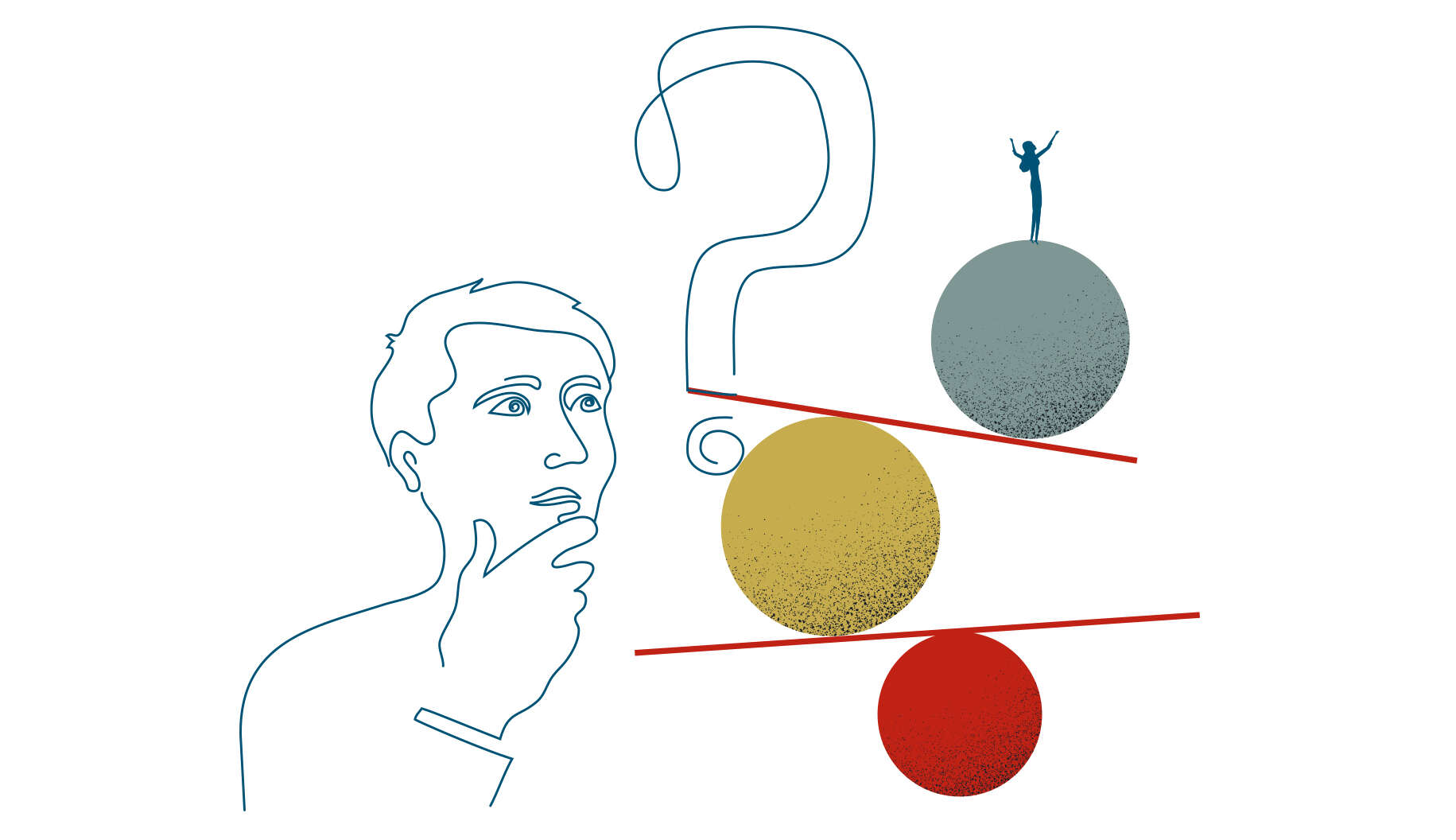Da mag ja an dem einen oder anderen durchaus etwas dran sein.
Doch: Wir leiden mindestens ebenso am Zuviel. Als Kirche haben wir zu viele Regeln. Zum Beispiel, wer mit welchen Voraussetzungen zu etwas zugelassen wird: zur Firmung, zur Weihe, zum kirchlichen Dienst als Seelsorgerin oder als Seelsorger. Wir haben, finde ich, viel zu viel Angst vor der Zukunft – und vergessen dabei zuweilen, auf die Heilige Geistkraft zu vertrauen.
Was mir auch auffällt: Ich bemerke oft eine zu grosse Gewissheit in Bezug auf Gott. Wenn Seelsorgerinnen, Katecheten oder Priester von Gott reden, als wüssten sie genau, wie Gott ist, dann zieht es mir den Magen zusammen. Oder vielleicht ist es auch das Herz? Gott ist doch so ganz anders, neu und unerwartet! Wie könnten wir dann abschliessende Antworten auf das Wesen Gottes erkennen?
In der Kirchengeschichte war – vor allem in der Zeit der Kirchenmütter und -väter – eine «negative Theologie» verbreitet. Negativ ist hier nicht als Wertung zu verstehen. Negativ bezieht sich auf den Verzicht auf alle «positiven» – also bejahenden – Aussagen. Dahinter steht die Überzeugung, dass wir stets mehr darüber aussagen können, wie Gott sicher nicht ist – als darüber, wie Gott ist.
Diese Form der «intellektuellen Enthaltsamkeit» gefällt mir. Sowieso halte ich es bei Aussagen über Gott gerne mit dem Theologen Dietrich Bonhoeffer, der einmal geschrieben hat, «einen Gott, den es gibt, gibt es nicht». Gott, so sagt Bonhoeffer damit, ist nichts, das in diesem Sinne «ist», wie wir «Sein» in unserem Leben erfahren. Gott ist nichts zum Anfassen, zum Begreifen oder zum Festhalten. Gott ist weder statisch noch abschliessend. Vielleicht, um es mit einem anderen Bild zu versuchen: Gottes Sein ist im Werden. So lesen wir in der Bibel, dass auch Gott sich in der Auseinandersetzung mit den Menschen weiterentwickelt. Göttlichkeit und Menschlichkeit – und deren jeweilige Entwicklung – sind aufeinander bezogen.
Wahrscheinlich aber ist die Frage nach dem Wesen Gottes gar nicht so wichtig – so wie es ja auch nicht wichtig ist, welches «Wesen» jene Menschen haben, die wir lieben. Vielmehr ist es das Verhältnis zu uns, die Verbundenheit, die zählt. Es geht um die Auswirkungen auf unser eigenes Leben, darum, wie wir uns verändern lassen, wie wir selbst für Gottes Wirken offen sind und diesem Wirken Möglichkeiten lassen und Raum geben.
Weniger wäre mehr – dieser Grundsatz ist also für uns als Kirche angebracht. Und doch: Als Glaubensgemeinschaft gilt in verschiedener Hinsicht auch das genau Gegenteil: Mehr ist mehr! Nämlich mehr Mut im Einsatz für die Zukunft. Mehr Demut bei allem, was wir gar nicht wissen können. Mehr Vertrauen auf das Unerwartete Gottes. Und in diesem Sinne mehr Gelassenheit mit allem, was anders läuft als erwartet.